
Reifen mit innovativer Radialkarkasse für mehr Grip, Komfort und Sicherheit. Die größere Auflagefläche sorgt für optimales Fahrverhalten und punktuelle Verformung. Das spezielle Profil mit vielen Stollen bietet maximale Kont

277 Artikel
Für alle, die keinen Raketenwissenschafts-Abschluss in Velopneumatik haben, gibt es direkt gute Nachrichten: „Wenn‘s nicht eckig ist, dann rollt‘s“. Das gilt auch für den ersten und hoffentlich einzigen Kontaktpunkt zwischen Boden und deinem Lieblingsfahrrad, egal ob es auf Asphalt oder im Gelände zu Hause ist – oder auf beidem. Aber ob es das auch maximal schnell, sicher, dauerhaft und zu deiner vollsten Zufriedenheit tut, darauf hast du mit der Wahl deines Pneus großen Einfluss. Warum? Ganz einfach: Weil Breite, Materialzusammensetzung, Profilierung, Gewicht, Luftdruck und Co. das Fahr- und Rollverhalten deines Bikes beeinflussen und damit auch deinen Energiehaushalt und deine Sicherheitsreserven bei sportlicher Fahrweise.
Und je weiter weg man sich von sporadischem Alltagseinsatz in Richtung ambitioniertem Radsport bewegt, umso mehr gewinnen diese Dinge an Bedeutung. Das heißt also, egal was für einen Schlappen du auf deinem Bike hast, fahren wird es immer. Nur wie, das hast du selbst in der Hand, abhängig von deiner Fahrweise, deinem Gewicht, deinem Bike und dem Untergrund, auf dem du unterwegs bist.. Interessiert dich das nicht, ist das auch kein Problem, du kommst trotzdem an dein Ziel. Willst du aber an der einen oder anderen Optimierungsschraube drehen, haben wir einen ganzen Haufen sachdienlicher Informationen für dich, damit du dich bestens im nahezu unendlichen Angebotskosmos der Fahrradreifen aus den einzelnen Bike-Segmenten orientieren kannst.
Wir haben für jeden Einsatzzweck Reifen bester Marken wie Continental, Cadex, Giant, Maxxis, Michelin, Panaracer, Pirelli, Schwalbe und WTB im Programm.
Tubeless oder Schlauch? Montagetipps Welche Reifen für welchen Einsatzbereich? Alle Infos zum Luftdruck








Reifen mit innovativer Radialkarkasse für mehr Grip, Komfort und Sicherheit. Die größere Auflagefläche sorgt für optimales Fahrverhalten und punktuelle Verformung. Das spezielle Profil mit vielen Stollen bietet maximale Kont


Presta-Ventile in 44mm, 60mm und 80mm Länge.
Passend für die Mehrheit der Tubeless-Felgen – Kompatibilität im Zweifel beim Felgenhersteller nachsehen.
Wie so oft im Bike-Sektor gilt: Frag dich, was du willst, dann bekommst du, was du brauchst. Schließlich ziehst du zu deinem Bergsteiger-Outfit auch keine Lackschuhe an. Und genauso verhält es sich bei den Reifen deines Vertrauens auch.





Auf Asphalt
Im Gelände verhält es sich grundsätzlich ähnlich, bei einigen Punkten aber durchaus etwas anders:
Wenn jetzt aus dem kühlen Nass ein eisiges wird, kann man im Straßenverkehr ein kleines bisschen mehr an Halt mit Reifen, in deren Mäntel Metallpins (sogenannte Spikes) integriert sind, erreichen. Aber auch mit diesen kleinen Helferlein gilt: Glatt bleibt glatt und ist kein idealer Untergrund zum Fahrradfahren und oft einfach zu gefährlich. Im MTB-, Road- oder Gravelbereich haben solche Techniken keine Relevanz.
Der Luftdruck ist neben der Gummimischung der wichtigste Faktor für Bodenhaftung und Rollwiderstand deines Fahrradreifens. Ebenso beeinflusst er, wie langlebig dein Reifen ist. Grund genug also, ihm ausreichend Beachtung zu schenken, nachdem man sich für ein ja meist gar nicht so günstiges Pneu Modell entschieden hat. Es gibt ein paar Faustregeln, an die man sich auf der Suche nach den individuellen Lieblingsluftdruck, der sich ja an eigenem Systemgewicht (= Fahrer:in, Fahrrad, Ausrüstung/Gepäck), Einsatzbereich, Fahrstil und Art des Fahrradreifens orientieren sollte:
Nicht zu wenig!
Nicht zu hoch!


Reifen verlieren übrigens ständig etwas Druck, je mehr vorher drin war, umso schneller – egal ob schlauchlos oder mit Schlauch gefahren. Und das tut ihnen, gerade wenn das Bike länger steht, gar nicht gut und verkürzt ihre Lebensdauer durch Materialermüdung. Wer also nicht eh den Druck regelmäßig checkt, ob er zum Untergrund der gerade angedachten Ausfahrt passt, sollte auch ab und an in Keller oder Garage vorbeischauen, bevor der zweirädrige Liebling platt auf der Felge steht.

Die Lauffläche eines jeden Fahrradreifens besteht aus Gummi. Wie da die perfekte Zusammensetzung für den jeweiligen Einsatzbereich ist, ist eine wahre Wissenschaft für sich. Um sich nicht komplett auf der Suche nach dem perfekten Materialgebräu zu verlieren, gibt es auch hier ein paar Leitplanken, die eigentlich auch immer ganz logisch sind:

Es gibt unzählige Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Inhaltsstoffe einer Gummimischung, die die Haftungs- und Rolleigenschaften der Lauffläche beeinflussen. Weil man aber nicht an jeder Stelle die gleichen Eigenschaften braucht, kombinieren die Hersteller - besonders im MTB-Bereich – auch oft auch mehrere verschiedene Mischungen an einem Fahrradreifen:
Die Anforderungen an Fahrradreifen variieren je nach Einsatzzweck enorm:
Mountainbike – Grip & Kontrolle sind alles
Rennrad – Geschwindigkeit zählt
Gravelbike – Der Allrounder
City- & Trekkingbike – Komfort & Sicherheit
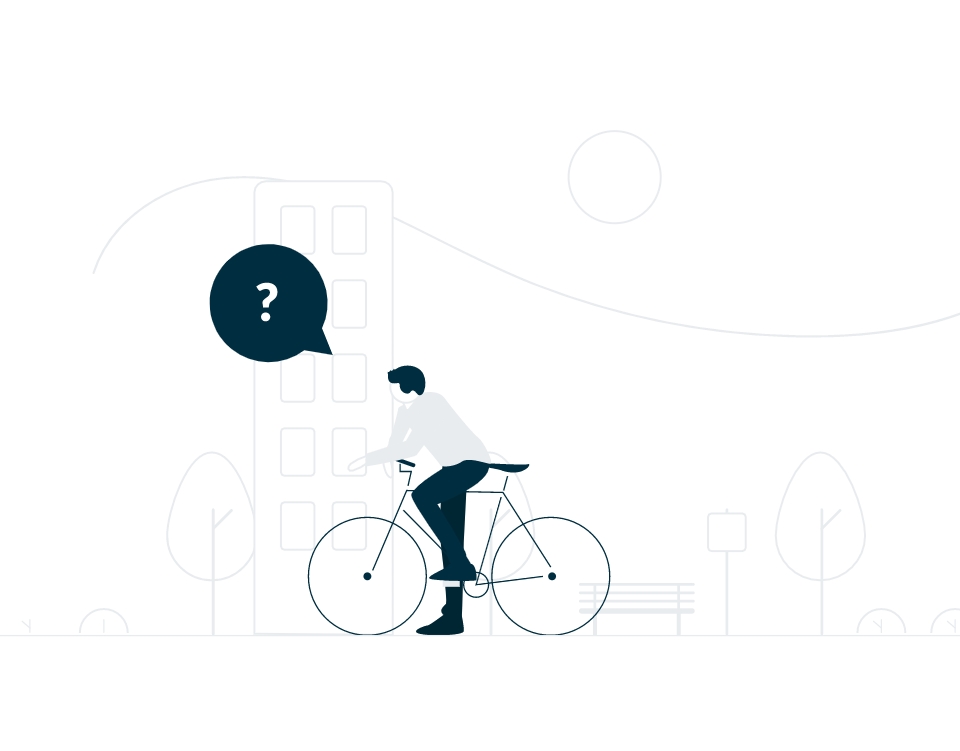

Ursprünglich hauptsächlich im Mountainbike-Bereich daheim, etabliert sich das „tubeless“ fahren, also der Verzicht von einem klassischen Fahrradschlauch zugunsten von Dichtmilch, die in einen speziellen Tubeless-Reifen gefüllt wird, zunehmend auch mehr in allen anderen Spielarten des Radfahrens, sogar im Rennrad-Sektor. Warum?
Ganz einfach: Es spart Energie, Gewicht, Rollwiderstand und Flickzeiten, wenn man sich den Schlauch spart:
Diesen ganzen Vorteilen steht die Mär der brutalen Sauerei entgegen, die man beim Aufziehen von Tubeless-Reifen fabrizieren soll. Dazu sei nur gesagt: Wenn man es richtig macht, geht das tippi toppi auch ohne sich, Fahrrad und Umgebung in Dichtmilch zu baden.

Fast alle kennen die Angabe der Fahrradreifengröße in Zoll, wie man sie auch beim Fahrrad selbst gängig sind: 29 Zoll, 28 Zoll etc.. Bei Reifen ist der Zoll-Höhenangabe des Außendurchmessers dann meist noch seine Breite, ebenfalls in Zoll, nachgestellt, z.B. 28 x 1.40. Allerdings sind diese Größenangaben, da vom Außendurchmesser des Fahrradreifens ausgehend, nicht immer eindeutig. So werden Reifen mit unterschiedlichem Innendurchmesser unter der gleichen Zollangabe geführt, erklärt das mal eurer Felge. Und mal ehrlich, wer rechnet schon in Zoll? Deswegen ist die heute am weitesten verbreitete Angabe für Reifenabmessungen die in
ETRTO (Europäische Reifen- und Felgennorm)
Englische Bezeichnung in Zoll
28 x 1.40 bedeutet einen ca.-Außendurchmesser von 28 Zoll und eine Breite von 1,4 Zoll.
Französische Bezeichnung in Millimetern (mm)

Fahrradreifen ist nicht gleich Fahrradreifen, auch wenn sie alle rund sind. Man unterteilt sie, was ihre Machart angeht, in mehrere Kategorien.
Drahtreifen (Clincher):
Faltreifen:
Schlauchreifen (Tubular/Collé):

Ein Fahrrad Reifen besteht aus Reifenwulst bzw. Wulstkern, der Karkasse, gegebenenfalls einem Pannenschutz und der Lauffläche aus Gummi.

Das Fahrradreifen wechseln kann die sprichwörtliche Pest am A…. llerwertesten sein. Kann wohlgemerkt, muss aber nicht! Von „easy peasy in 15 Minuten“ bis zu einem Friedhof aus abgebrochenen Reifenhebern zu Füßen des oder der leise vor sich hinweinenden Wechselwilligen ist alles drin, je nach Willigkeit des zu montierenden Pneus und den vorhandenen eigenen Skills. Spaß beiseite, im Normalfall ist der Tausch eines Reifens an einem Biobike kein Hexenwerk.
Und auch am E-Bike kann das mit entsprechendem Fachwissen auch ein Laie machen (hier aber Augen auf bei der Demontage des Hinterrades, das kann je nach Hersteller auch mehr bedingen als nur „Schrauben auf, Kette runter und Rad raus“!).
Wenn es mal aber wortwörtlich am Felgenhorn hakt, weil der Fahrradreifen weder Hü noch Hott macht, kann es schon unschön werden. Nicht umsonst hat die Süddeutsche Zeitung im November 24 dem Thema eine ganzseitige Klageschrift mit dem Titel „Die Reifenprüfung“ gewidmet. Weswegen nachstehend ein paar gute Tipps kommen.
Damit das große Heulen und Wehklagen beim Reifenaufziehen möglichst ausbleibt, gibt es ein paar Dinge, die man beachten sollte:
Lässt sich der wirklich vollständig luftleere Fahrradreifen erst gar nicht demontieren, weil er wie zementiert an der Felge sitzt, gibt es wenige zielführende Strategien jenseits des geduldig von Hand am Reifen Walkens.

.jpg)